
Was macht die COPD zu einer heimtückischen Krankheit?
Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ist eine Krankheit, die mit einer chronischen Entzündung in den Atemwegen einhergeht und nicht geheilt werden kann – und die obstruktiv, d.h. mit einer Verengung der Atemwege in der Lunge, einhergeht.
Wie entsteht COPD? Die Hauptursachen sind:
- Rauchen (etwa 80 % aller Fälle)
- schädliche Stoffe am Arbeitsplatz (15 %)
- Umwelteinflüsse (5 %).
Inzwischen sind auch Menschen betroffen, die nie geraucht haben. Der fortgesetzte Kontakt mit den Auslösern führt irgendwann zur Entzündung, die die Krankheit ausmacht und zu den Beschwerden führt.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Als Entzündung bezeichnen wir eine Reaktion unseres Körpers, mit der dieser auf verschiedene Auslöser reagiert, und auf diese Weise ausschalten will. Das gelingt ihm jedoch nicht immer und so kann sein Bemühen auch zu einer chronischen Entzündung führen, besonders dann, wenn der Auslöser seinen Schaden fortsetzen kann. Ursachen von Entzündungen können neben Krankheitserregern wie Bakterien, Viren und Pilzen auch Rauch, Allergien, Stäube u.v.m. sein. In vielen Fällen finden wir die Entzündung, kennen den Auslöser aber nicht, noch nicht.
Bei der COPD beeinträchtigt die zunehmende Schädigung der Schleimhaut auch den sogenannten Selbstreinigungsmechanismus.
Erklärung: Die Schleimhäute unserer Atemwege sind mit Zellen ausgekleidet, die Flimmerhärchen tragen oder Schleim bilden. Die Schleimbildenden Zellen bilden entweder einen dünnen oder zähflüssigen Schleim. Die Flimmerhärchen schwimmen im dünnflüssigen Schleim, schlagen wie ein Kornfeld im Wind und schieben den oben aufliegenden zähflüssigen Schleim in Richtung „Ausgang“. Auf diese Weise werden eingeatmete Fremdkörper, wie Staub, Viren, Bakterien u.ä., innerhalb weniger Stunden aus den Atemwegen hinausbefördert, ohne dass wir davon Notiz nehmen. So haben auch Krankheitserreger nur eine begrenzte Zeit, um eine Infektion auszulösen.
Die chronische Entzündung schädigt die Oberfläche der Schleimhaut
- Flimmerhärchen werden gelähmt oder fallen aus.
- Zahlreiche Zellen, die die Flimmerhärchen tragen, sterben und werden durch „billiges“ Narbengewebe ersetzt. Es entstehen Lücken im „Fließband“, in denen der Schleim liegenbleibt. Und Schleim ist für Bakterien eine „Delikatesse“.
- Die Schleimbildenden Zellen verlieren die Fähigkeit, den richtigen Schleim zu bilden. Sie bilden entweder weniger oder einen schlechteren Schleim, der seine Funktion nicht mehr erfüllen kann.
- Zusätzlich entstehen neue Schleimzellen, die einige Betroffene im übermäßig gebildeten Schleim regelrecht zu ertränken drohen.
- Zum „krönenden“ Abschluss beginnen sich die Atemwege langsam aber zunehmend zu verengen.
Die Summe dieser Veränderungen gibt eingeatmeten Erregern zunehmend mehr Zeit, sich in der Schleimhaut einzunisten, sich zu vermehren und Infektionen zu verursachen. Jede Infektion hinterlässt irreparable Schäden, die das Fortschreiten der Krankheit beschleunigen.
Die daraus folgenden Beschwerden werden zu quälenden Begleitern im Leben der Betroffenen:
- Auswurf: Der schlechte oder zu viel gebildete Schleim muss aktiv beseitigt werden.
- Husten: Der Husten muss die Aufgabe des Selbstreinigungsmechanismus übernehmen, ist Ersatzmechanismus, um Schleim und Fremdkörper zu beseitigen. Hustenreiz ist nebenbei bemerkt eines der quälendsten Symptome.
- Atemnot: Bei körperlicher Anstrengung stößt jeder Mensch an seine Grenze, wenn der für die Leistung erforderliche Sauerstoffbedarf nicht mehr schnell genug gedeckt werden kann. Er muss die Belastung wegen Luftnot abbrechen.
Werden die Atemwege enger, wird die Belastungsfähigkeit je nach dem Grad der Enge früher auftreten als bei einem Gesunden. Zuerst wird diese Luftnot erst bei starker Anstrengung auftreten, mit zunehmender Enge aber immer früher, d.h. bei immer leichterer Anstrengung zu verspüren sein. Vergleich: Durch einen Feuerwehrschlauch fließt mehr Wasser pro Minute als durch einen Gartenschlauch.
Wie fühlt sich Luftnot an?
Wer wissen möchte, wie sich Luftnot anfühlt, kann dies in einem Selbstversuch leicht erfahren:
- Nehmen Sie einen oder zwei Trinkhalme in den Mund, umschließen Sie diese eng mit den Lippen und verschließen Sie die Nase mit zwei Fingern oder einer Wäscheklammer.
- Atmen Sie nun ausschließlich durch den oder die Trinkhalme.
- Wenn Sie nun eine Treppe hinaufsteigen, werden Sie unweigerlich spüren, wie schwer es ist, ausreichend Luft zu bekommen.
- Wenn Sie zur Erleichterung nun die Trinkhalme und Klammer beseitigen, bedenken Sie, dass dies ein Patient mit verengten Atemwegen nicht kann. Er muss lernen, mit der Einschränkung zurechtzukommen.
Unter diesen Bedingungen muss es für die COPD lauten: Mögliche Auslöser am besten meiden! Hat der Krankheitsprozess der COPD einmal begonnen, ist eine Heilung nicht mehr möglich! Der Krankheitsprozess kann nur noch in seiner Geschwindigkeit positiv beeinflusst, also gebremst werden. Die „Brandbeschleuniger“ der COPD sind:
- fortgesetzter Kontakt mit dem / den Auslöser/n
- Jeder Infekt der Atemwege
Daraus folgt: Eine COPD muss so früh wie möglich festgestellt werden! Je früher und konsequenter der oder die Auslöser beseitigt werden und je seltener Infektionen auftreten, desto langsamer wird die Krankheit fortschreiten.
Das Problem der Früherkennung
Die Symptome Auswurf, Husten und Atemnot (AHA) gelten immer noch als Frühwarnzeichen der COPD. Wer die oben erwähnten Informationen korrekt bewertet, muss unweigerlich zu der Überzeugung gelangen, dass sie die Folge der Erkrankung sind. Wenn diese Symptome auftreten, ist die Krankheit bereits voll etabliert und es gibt keinen Weg mehr zurück.
Werden diese Symptome bei einem Arztbesuch festgestellt, und wir machen Betroffene darauf aufmerksam, wird die potenzielle Gefahr in vielen, zu vielen Fällen von den Angesprochenen verharmlost:
- Wer hustet nicht?
- Das bisschen Auswurf!
- Ich habe keine Luftnot!
Viele der Angesprochenen wissen um den Nachweis einer Obstruktion in einer Lungenfunktionsuntersuchung zur Feststellung einer COPD und bitten um den „Beweis“. Wenn die Lungenfunktion dann „noch“ normal ist, weil die Krankheit eben noch am Anfang steht oder weil dieser „Erkrankte“ zu denjenigen zählt, die noch keine Obstruktion entwickelt haben oder nicht entwickelt werden, fühlen sie sich in ihrer Ablehnung bestätigt.
In Wahrheit steckt hinter dieser Ablehnung in der Regel die Angst, das liebgewonnene Rauchen aufgeben zu müssen.
In vielen Fällen wird die COPD spät, zu spät entdeckt. Zum ersten Mal kommt es anlässlich einer Infektion zu einer spürbaren Luftnot. Und dann bestätigt eine deutlich verschlechterte Lungenfunktionsuntersuchung, dass die Krankheit lange Zeit unbehindert fortschreiten konnte.
Was bis jetzt an Lungenfunktion verloren ist, ist unwiderruflich verloren
Wollen wir wirklich etwas im Kampf gegen die COPD und zum Wohle der Betroffenen erreichen, müssen wir somit nach Hinweisen suchen, die uns signalisieren, dass hier eine COPD noch nicht begonnen hat, vielleicht aber zu beginnen droht.
Unser Problem ist also nicht nur, dass wir (noch) nicht wissen, warum und über welchen Mechanismus die erwähnten Auslöser diese chronische Krankheit auslösen und nähren, wir wissen leider auch (noch) nicht, was uns auf den drohenden Beginn hinweisen könnte.
Es gibt einige mögliche Hinweise, wie z.B.
- Die COPD betrifft Menschen über 40 Jahre mit Schädigung, vornehmlich durch Rauchen. Wir können einem Raucher aber nicht die Entwicklung einer COPD vorhersagen. Wir wissen zwar, dass von 100 COPD 80 Raucher sind, aber von 100 Rauchern entwickeln „nur“ etwa 30 eine COPD. Der Zusammenhang von Alter plus Rauchen und eine der folgenden Auffälligkeiten sollte hellhörig machen und weitere Untersuchungen auslösen.
- Ein zeitlich verlängerter Infektverlauf. Bei gesunden Menschen verschwinden die Infektbeschwerden innerhalb von 14 Tagen. Alles, was darüber hinausgeht, sollte hellhörig machen.
- Oftmals geht bei einer vorgeschädigten Schleimhaut der Virusinfekt in einen bakteriellen Infekt über. Patienten mit geschädigter Schleimhautoberfläche erkranken häufiger an einer bakteriellen Bronchitis als Menschen mit gesunden Atemwegen. Mehr als ein bakterieller Infekt pro Jahr ist schon verdächtig.
- Liegt ein bestimmter Wert in der Lungenfunktion im unteren Drittel des Normalbereiches (FEV1) und sinkt in einem Jahr um mehr als 40 ml, hat die betroffene Person ein 30-fach höheres Risiko, an einer COPD zu erkranken.
Quellen:
– Foto: Nenad Cavoski / istock.com




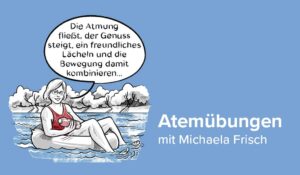
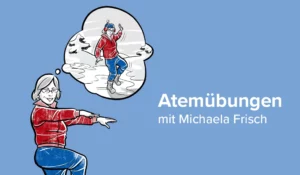
Es ist sehr gut , über diese Medien mit gleich gesinnten Menschen sich auszutauschen.
Ich habe COPD Stufe 2 , Asthma und ein Emphysem , ich hatte gerade einen Kuraufenthalt an der Ostsee in Heiligendamm in der Median Klinik, was ich jedem empfehlen kann. Ich habe viel Kraft und Energie getankt. Es ist für Lungenkranke die Beste Klinik. Sehr gute ärztliche Versorgung und intensive Anwendungen.
Ich habe die COPD auch zu spät erfahren.Bin zuspät zu einem Lungenfacharzt gegangen, weil meiner nicht mehr im Dienst, pensioniert war, gegangen. Ich bekomme vonmeinem Artzt keine Tipps, keine Ratschläge, muss alles aus der „Nase ziehen.“ Hinzu kommt, dass er in der Nachbarstadt praktiziert. Der Weg ist mir auf die Dauer zu weit, ich muss mich anderweitig orientieren. Habe jetzt auch eine Selbsthilfegruppe gefunden. Ich muss immer sop viel gähnen. Hat das auch mit COPD zu tun? Müde bin ich nicht.Ich schlafe immer mindestens 7 Stunden.
Zuerst einmal hoffe ich, dass meine Beiträge Ihnen die wichtigen Informationen vermitteln kann. Werden Sie zum Experten Ihrer Krankheit. Vielleicht könnte Ihnen Lungensport helfen, verlorene Leistungsfähigkeit zurückzugewinnen. Dazu im nächsten Beitrag
Es ist nicht entscheident wie viele Stunden geschlafen wurde. Um heraus zu finden ob der Schlaf auch gut ist sollte dieser im Schlaflabor geprüft werden.
Bei mir hatte sich herausgestellt, dass Nachts der Sauerstoff in den Keller ging. Kann jedoch mit entsprechenden Geräten gebessert werden.
Ich kann Ihren Unmut, ja „Wut“ nur zu gut verstehen. Das sind Gründe, warum ich mich seit Jahrzehnten für eine Frühdiagnose und Suche nach frühen Warnzeichen angeregt habe.
Offensichtlich sind Sie schlecht aufgeklärt. Der Arztbesuch sollte nicht zum Verordnen der Medikamente sein, sonder:
Gelegenheit zur Frage, ob man die Therapie optimieren kann und ob Sie korrekt inhalieren. Wenn sie falsch inhalieren , kann es nicht helfen, weil in den Bronchien nichts ankommt.
Auch zur Sauerstofftherapie sind Sie nicht aufgeklärt. NUR, wenn Sie es für nötig halten oder wollen, ist so als ob Sie es gar nicht machen. KEIN bis kaum Effekt. Für die meisten Patienten gilt, möglichst so viele Stunden pro Tag, wie eben möglich.
Bedrängen Sie Ihren Arzt! Viel Erfolg
Moin, Ihr Artikel ist nicht schlecht, aber leider liest man das erst, wenn es zu spät ist, Ich habe laut Bericht Copd, 3d, Asbestose,, und Astma. Was auch immer der Name ist, ich bekomme bei der kleinsten Anstrengung keine Luft bzw, schlecht Luft. Also ist mit Bewegung auch nicht viel: Letztendlich geht man doch nur noch alle 3 Monate zum Arzt um sich die Medikamente verschreiben zu lassen.
Ich finde, dass ein verständnisvoller Arzt , der nicht mit Sport und Bewegung in diesen fällen dumme Sprüche macht das wichtigste ist, weil helfen kann auch der nicht mehr. Ich habe auch mobilen und Stationären Saustoff, die ich bei Bedarf nehme. Auch im Urlaub geht das ganz gut.
Trotzdem freu ich mich wenn die Sonne wieder scheint
Gibt es COPD 3 ohne auswurf und Husten ? Nur Atemnot, Luftnot?
Ja, so wie es auch Husten und Auswurf ohne Luftnot gibt.
Hallo Andrea,
das hatte ich jahrelang ….. COPD Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, aber weder Husten noch Auswurf. Erst in den letzten zwei bis drei Jahren muss ich ab und an husten.
Hallo, von dem Trixeo hatte ich schon wiederholt Polypen auf dem Stimmband.
Birgt es Probleme, wenn ich in dieser Zeit das Medikament absetze?
Beste Grüße
Mir ist nicht bekannt, dass einer der drei Inhaltsstoffe Stimmbandpolypen macht. Selten aber möglich ist eine Pilzinfektion im Rachenraum und auch Stimmbandbereich. Hier kann die Behandlung bei der Therapie fortgesetzt, muss nicht unterbrochen werden. Sollte das öfter vorkommen oder zu Heiserkeit führen, kann die Inhalation über eine Vorschaltkammer – Spacer – hilfreich sein. Wenn auch das nicht hilft, sollte ein Präparat mit einem anderen Kortison gewählt werden.
Dieser Artikel ist sehr gut. Er spiegelt, dass oftmals nicht von den Fachärzten Tipps gegeben werden.
Ich kann nur empfehlen, sich vor dem Arztbesuch Fragen zu notieren und den Arzt damit zu „löchern“
Leider bringt das bei meinem jetzigen LuFa rein gar nichts.
Bin gespannt was er meint nachdem ich ohne sein wissen Trimbow abgesetzt habe. Nachdem ich hier erfahren habe, dass die Muskelkrämpfe usw. von diesem kommen können habe ich den Waschzettel mal genauer auch Nebenwirkungen durchforstet. Meine Krämpfe sind so gut wie alle weg und auch die täglichen Kopfschmerzen.
Es kam wie erwartet.
Er diskutiert nicht mit Patienten. Die Nebenwirkungen kommen angeblich nicht vom Medikament. Den Beipackzettel habe ich erst, nachdem hier von einigem geschrieben wurde, durchsucht.
Was ich komisch finde – ein Arzt sollte er nicht Englisch können? Es ging darum ob sich mit mobiler Konzentrator auf Dauerfluss umstellen lässt.