
„Vor der Therapie steht die Diagnose“ (Rudolf Virchow)
Die Bedeutung dieser „Forderung“ wird klar, wenn wir daran denken, dass eine Therapie nur erfolgreich sein kann, wenn die Diagnose mit Sicherheit korrekt ist!
Der gute Weg zu einer Diagnose beginnt immer mit einer guten Befragung und sorgfältigen Untersuchung des Kranken. Im Anschluss daran sollte zumindest ein Verdacht bestehen, der mit weiteren Untersuchungen bestätigt oder ausgeschlossen wird.
Es bleibt die Frage: „Was macht die COPD zu einer heimtückischen Krankheit?“
Leider typisch für die COPD ist, dass die Krankheit erst spät, für das Leben und die Lebensqualität des Betroffenen zu spät entdeckt wird. Zu spät, weil Schäden, die jetzt bereits vorliegen, nicht mehr zu beheben sind!
Warum wird die COPD oft zu spät erkannt?
Plötzlich und aus vermeintlich heiterem Wohlbefinden verspürt der Betroffene zum ersten Mal in seinem Leben Luftnot anlässlich eines Infektes. Die daraufhin vorgenommenen Untersuchungen ergeben leider oft einen bereits beachtlichen Verlust an Lungenvolumen.
Eigentlich kaum vorstellbar, dass es so weit kommen konnte, ohne dass der Betroffene davon etwas mitbekommen hat, oder? Die Erklärung ist recht einfach: es gibt keine wirklich typischen Beschwerden, die den Patienten zum Arztbesuch veranlassen. Ein Mensch, der unter Asthma leidet, weiß schnell, dass er zum Arzt muss. Er kennt Phasen, wo er aus heiterem Wohlbefinden plötzlich unter quälendem Hustenreiz, vielleicht auch Engegefühl beim Atmen leidet, vielleicht sogar Luftnot verspürt, und auch wieder Phasen, wo er „völlig“ ohne Beschwerden ist. Er weiß somit zwischen „Gut“ und „Böse“ zu unterscheiden. Das macht ihn sozusagen hellhörig, weckt seine Aufmerksamkeit. Zur Vollständigkeit muss erwähnt werden, dass auch ein Asthma Stolpersteine bietet, die häufig auch erst spät zur korrekten Diagnose führen. Ganz anders bei der COPD.
Die COPD beginnt schleichend. Das „Feuer“ der Krankheit glimmt zu Beginn nur leicht. Der Betroffene merkt gar nicht, dass er krank ist und in sein Verderben schlingert. So hat die COPD lange Zeit, d.h. viele Jahre, unwiderrufliche Schäden zu verursachen.
Frühe Warnzeichen: AHA – Auswurf, Husten, Atemnot
Als frühe Hinweise auf eine COPD gelten seit Jahrzehnten A H A = Auswurf, Husten und Atemnot. Leider aber müssen wir feststellen, dass AHA uns bei der möglichst frühen Feststellung der Diagnose im Stich lassen. Der „AHA-Effekt“ kommt zu spät!
Die Erklärung ist einleuchtend:
- Auswurf – der gesunde Mensch hat keinen Auswurf. Er bildet ausreichend viel, aber nicht mehr Schleim als benötigt wird und in hoher Qualität, der den gesunden Selbstreinigungsmechanismus ermöglicht. Zu Auswurf kommt es erst, wenn mehr Schleim gebildet wird, als benötigt. Dieser ist dann meistens auch noch von schlechter Qualität, ungeeignet für seine eigentliche Aufgabe. So etwas geschieht akut im Rahmen eines Infektes oder chronisch, wenn die Schleim bildenden Zellen krank sind, wie zum Beispiel bei der COPD.
- Husten – Der Gesunde kennt keinen Hustenreiz! Hustenreiz tritt immer auf, wenn das lautlos arbeitende „Fließband“ des Selbstreinigungsmechanismus geschädigt oder überfordert ist.
Akut kann das der Fall sein im Verlaufe eines Infektes:
- trockene Bronchitis: Die Schleimhaut ist gereizt, rot geschwollen und völlig trocken. Es wird kein oder zu wenig Schleim gebildet. Hier ist der Auslöser für den Hustenreiz die trockene und entzündete Schleimhaut, wo die vorbeistreichende Luft zu einem „Schmerz“ führt, wie Wasser auf einer Schürfwunde, und einen Hustenreiz auslöst.
- feuchte Bronchitis u.ä.: Hustenreiz tritt auch auf, wird zum Muss, wenn zu viel Schleim oder Sekret die Atemwege füllt. In diesem Fall steigert der Husten den Abtransport des Schleimes / Sekretes und verhindert das „Ertrinken“ des Betroffenen in seinem eigenen Schleim.
- Verschlucken: Größere „Fremdkörper“ können durch die kurzen Flimmerhärchen nicht „hinausgetragen“ werden. Sie müssen mit großem Kraftaufwand, eben durch den Hustenstoß hinausgeschleudert werden. Diesen rettenden Hustenreiz kennt Jeder, wenn er sich einmal verschluckt hat.
- chronischer Hustenreiz ist die Folge, wenn die Schleimhaut dauerhaft geschädigt ist, wie zum Beispiel bei der COPD. Chronisch wird dieser Hustenreiz, wenn den Betroffenen ein permanenter Reiz der Entzündung quält oder zu viel und dazu auch noch qualitativ schlechter Schleim gebildet wird.
Wie funktioniert der Husten?
Bei einem Hustenreiz atmen wir im Reflex, d.h. ohne aktives Zutun, tief ein und verschließen die Stimmbänder, damit keine Luft mehr entweichen kann. Jetzt wird der Brustkorb mit der Kraft aller Atemmuskeln zusammengedrückt, der Druck im Brustkorb auf ein Maximum gesteigert. Plötzlich werden dann die Stimmbänder geöffnet und die Luft entweicht mit hoher Geschwindigkeit und reist den „Eindringling“ oder zu viel gebildeten Schleim mit sich.
Die Gewalt des Hustenstoßes: Am Mund können wir eine Windgeschwindigkeit bis zu 400 km/h messen. Also eine richtige Gewalt, die dabei losgetreten wird. Auch verständlich, dass man sich bei gewisser Vorschädigung beim Husten sogar eine Rippe brechen kann.
Bei der COPD kann es zusätzlich zur Entzündung der vorhandenen Schleimzellen zu einer Vermehrung dieser Zellen kommen. Alle Schleim bildenden Zellen können nicht nur vermehrt Schleim bilden, nein, dieser ist auch noch von minderer Qualität, der für den Selbstreinigungsmechanismus nicht genutzt werden kann. Er bleibt liegen und kann außer durch Husten nicht beseitig werden.
Atemnot ist der Schrei des Körpers, jeder einzelnen Zelle, nach Sauerstoff
Sie tritt immer dann auf, wenn unser Körper viel Sauerstoff benötigt, dieser aber nicht mehr schnell genug über die Atemwege zu den Lungenbläschen geschafft, dort aufgenommen und mit dem Blut zu den Zellen transportiert werden kann. Jeder Gesunde, auch Sportler, kennt Situationen, wo er eine anstrengende Tätigkeit wegen Luftnot abbrechen musste. Er hat die Grenze seiner Leistungsfähigkeit erreicht. Sportler trainieren, um mehr Leistung mit weniger Sauerstoff erbringen zu können. Der Transport von Sauerstoff im Blut wird gesteigert durch die vermehrte Bildung von Blutfarbstoff – Hämoglobin = LKWs für den Sauerstofftransport im Blut. Zusätzlich kommt es zur Verbesserung der Energiegewinnung in jeder einzelnen Zelle. Der Grund für Atemnot bei Asthma und COPD und den „gebremsten“ Fluss in den Röhren – Bronchien – ist eine Verengung – Obstruktion – der Atemwege.
Vergleich: Durch einen weiten Feuerwehrschlauch fließt deutlich mehr Wasser pro Minute als durch einen im Vergleich dazu dünnen Gartenschlauch. Vergleichbar lassen verengte Atemwege auch weniger Luft hindurch als gesunde, weite Atemwege.
Als wertvollen Hinweis auf eine Krankheit ist Luftnot bei der COPD schwer zu erkennen. Sie tritt nämlich nur auf, wenn sich der Betroffene anstrengt, an seine Leistungsgrenze gelangt. Leicht, nur zu leicht misst er dieser Luftnot keinen Krankheitswert bei. Schließlich ist er älter geworden und damit hat auch seine Leistungsfähigkeit abgenommen. Wer ist schon in der Lage, eine bestimmte Strecke ebenso schnell zurückzulegen wie in seiner Jugendzeit.
Warum Betroffene die Symptome oft unterschätzen?
Mit diesen Erklärungen dürfte klar sein, dass es dauert, bis diese Beschwerden auftreten oder als solche erkannt und vor allem auch als nicht normal anerkannt und als Grund für einen Arztbesuch angesehen werden. Und tritt eines oder mehrere dieser Beschwerden auf, ist die Krankheit schon fest im Gange und ein dauerhafter Schaden meistens schon eingetreten.
Schlimmer noch ist die Neigung, die Beschwerden zu bagatellisieren.
„Das bisschen Auswurf hat doch Jeder!“
„Wer hustet nicht?
„Ich bin halt keine 20 mehr, kann eben nicht mehr so schnell rennen!“
Das sind die typischen Ausreden, die ein Arzt auch oft zu hören bekommt, wenn ihm eines dieser Symptome aufgefallen ist, und er seinen Patienten darauf anspricht. Bei Rauchern sind diese Ausreden schlicht und einfach motiviert von der Angst, diese lieb gewonnene Angewohnheit aufgeben zu müssen. So schlimm sind die Beschwerden ja nicht, wird schnell, voreilig festgestellt. Damit sollte einleuchten, es ist die schwierige Aufgabe, bei noch gesunden, genauer gesagt, gesund erscheinenden Menschen nach Anzeichen zu suchen, die die drohende Gefahr ankündigen, am besten noch, bevor die Krankheit überhaupt begonnen hat. Wir sollten immer an die Heimtücke der COPD denken:
Ist die COPD gestartet, ist sie nicht mehr zu stoppen!
Es gibt ein paar Hinweise, die als Ankündigung angesehen werden können, aber leider nicht müssen. Hier muss die Devise lauten, lieber einmal zu oft und zu früh an die COPD denken als einmal zu spät.
Welche Hinweise könnten helfen, früher an die COPD zu denken?
Mögliche Indizien sollen noch einmal erwähnt werden: Unsere Haut und Schleimhäute sind ein Bollwerk gegen die Umwelt. „Nur“ durch eine Schädigung und der damit gestörten Abwehrfunktion können Krankheitserreger eindringen und eine Infektion auslösen. Dabei haben es die etwa hundert Mal größeren Bakterien deutlich schwerer, in die Atemwege zu gelangen und eine Infektion auszulösen, als die kleinen Viren. Kein Wunder also, dass normalerweise 80% aller Infektionen der Atemwege von Viren und nur 20% durch Bakterien verursacht sind.
Häufige Infektionen – Bronchitis u.ä.
Eine Schädigung der Schleimhaut muss zur Schädigung der Abwehr und damit für Viren und Bakterien zu einem leichten Spiel führen, sich hier einzunisten. Jetzt noch zu viel gebildeter und liegen gebliebener Schleim ist für Bakterien und Co eine reine Delikatesse und begünstigt das Angehen von Infektionen. Die Folge sind häufige Fälle von Atemwegsinfektionen.
Häufige bakterielle Infektionen
Bakterielle Entzündungen erfolgen selten sofort. Meistens sind sie die Folge eines Virusinfektes und den von diesem verursachten Schaden. Bei Menschen mit gesunden Atemwegen heilt die Virus-Infektion in der Regel innerhalb von ein bis zwei Wochen aus. Mit geschädigter Schleimhaut aber folgt dem Virusinfekt oft eine bakterielle Entzündung. Der Übergang vom Virusinfekt in einen bakteriellen Infekt erfolgt beim Gesunden verständlicherweise seltener als beim Patienten mit COPD und seiner vorgeschädigten Schleimhaut.
Verlängerter Infektverlauf
Der längere Infektverlauf durch verzögerte Heilung und vor allem das Aufeinanderfolgen von bakteriellem Infekt auf einen Virusinfekt sollte hellhörig machen.
Unsaubere Schleimhaut
Lässt der Arzt seine Patienten beim Abhören husten, kann leicht zwischen „sauberen“ und „schmutzigen“ also kranken Atemwegen unterschieden werden. Selbst ein medizinischer Laie kann schon beim Lachen gesund von krank unterscheiden.
Giemen – ein typisches Geräusch beim Abhören als Hinweis auf verengte Atemwege
Der Gesunde atmet nahezu geräuschlos. Jedes Geräusch, das beim Atmen zu vernehmen ist, sollte hellhörig machen. Giemen gibt es bei Gesunden nicht! „Man kann es nur bei Allergikern und Rauchern hören.“
Ist es eine COPD? Jeder noch so kleine Verdacht, dass hier eine COPD beginnen könnte, sollte Grund für eine Lungenfunktionsuntersuchung sein.
Die Lungenfunktionsuntersuchung- zentral für die COPD-Diagnose
Bei jedem Verdacht auf eine COPD ist die Lungenfunktionsuntersuchung die Untersuchung zum Ausschluss oder Nachweis einer Verengung – Obstruktion – der Atemwege. Leider nur wissen wir nicht, ob und wann im Verlaufe einer gestarteten COPD eine Verengung der Atemwege beginnt. So kann das Ergebnis der Untersuchung lange Zeit unauffällig sein, obwohl die Flammen der Entzündung einer COPD schon lange lichterloh brennen.
Für Betroffene, bei denen eine COPD vermutlich bereits begonnen hat, aber die Lungenfunktionsuntersuchung „noch“ unauffällig ist, führt das „noch (!) gute“ Ergebnis immer wieder dazu, die Gefahr auch demonstrativ abzulehnen. Der Patient findet sich in seiner ablehnenden Haltung bestätigt.
„Sehen Sie, Herr Doktor, die Lungenfunktion ist doch völlig in Ordnung!“
Festzustellen ist, die Diagnose COPD wird nicht durch eine Lungenfunktionsuntersuchung gesichert. Sie bestätigt nur eine eventuell vorliegende Obstruktion! Da mahnen die Worte zur Vorsicht und Änderung der Lebensgewohnheiten selten und die Krankheit erhält genug Zeit, weiter und ungehindert fortzuschreiten.
Die wiederholte Lungenfunktionsuntersuchung als ein bedeutender Hinweis
Jeder Mensch verliert ab etwa dem 25. Lebensjahr 25-50 ml Lungenvolumen. Dieser normale Alterungsprozess hat keine Auswirkungen, weil unsere Leistungsfähigkeit auch abnimmt, der Körper nicht mehr so viel Sauerstoff benötigt. Bei einem Raucher kann dieser Verlust je nach Empfindlichkeit 100 – 200 ml pro Jahr betragen.
Wird eine „normale“ Lungenfunktion im Abstand von einem Jahr wiederholt, kann die Veränderung eines bestimmten Wertes – FEV1 – ein Risiko für eine COPD bestätigen. Ist der Wert im Zeitraum von einem Jahr um mehr als 40 ml gesunken, ist das Risiko für die Entwicklung einer COPD im Vergleich zu Gesunden um 32-fach erhöht.
Bestätigung der Diagnose COPD
Ist in der Lungenfunktion eine Verengung – Obstruktion – nachgewiesen, wird ein Medikament zur Erweiterung über Inhalation – Einatmung – verabreicht. Eine COPD gilt als ziemlich sicher, wenn sich die Verengung – FEV1 – jetzt nur geringgradig – weniger als 12% – verbessert.
Ausschluss anderer Krankheiten mit vergleichbaren Symptomen
Zur Sicherheit sind jetzt noch ein paar wichtige Krankheiten auszuschließen, die ähnliche Beschwerden und Veränderungen der Lungenfunktion machen, sich in der Ursache und im Krankheitsgeschehen aber von der COPD unterscheiden und folgerichtig auch anders behandelt werden.
Es gibt eine Reihe von Veränderungen und Krankheiten, die Luftnot verursachen können:
- Zu wenig Sauerstoff in der Luft
Im Flachland enthält die Luft 21% Sauerstoff. Mit einem einzigen Atemzug sind 98% aller roten Blutkörperchen mit Sauerstoff beladen und die ausgeatmete Luft enthält immer noch 17% Sauerstoff. Nebenbei bemerkt, ist das der Grund, warum eine Inhalation von Sauerstoff beim Gesunden keinen Effekt haben kann! Erst in größeren Höhen kann der abnehmende Sauerstoffgehalt zum Problem werden. Hier kann Sauerstoffgabe helfen. - Verengte Atemwege
Sind die Atemwege verengt, kann die Luft nicht schnell genug in ausreichender Menge für den Gasaustausch – Sauerstoff rein, Kohlendioxyd raus – zu den Alveolen – Lungenbläschen gelangen. - Zu wenig Hämoglobin
Sauerstoff kann im Blut ausschließlich mit Hilfe von Hämoglobin – roter Blutfarbstoff – transportiert werden. Sie sind die LKWs für den Transport. Sind zu wenig rote Blutkörperchen – Erythrozyten – im Blut, liegt eine Blutarmut vor, kann der Sauerstoff nicht transportiert werden. Eine Sauerstoffgabe hätte keinen Effekt, fehlen doch die LKWs für den Transport. - Verengte Blutgefäße
Sind die Gefäße, Straßen verengt, haben es die LKWs schwer, ihr Ziel zu erreichen. - Schwaches Herz
Die Erythrozyten haben keinen Motor, sie müssen wie Rohrpost durch die Röhren „geschossen“ werden. Der Motor, der das Blut zum Fließen bringt, ist das Herz. Verständlich, dass die LKWs nicht liefern können, wenn der Motor geschwächt ist.
Jede dieser erwähnten „Störungen“ muss unweigerlich zu einer Sauerstoffnotlage in der Zelle führen und es muss Luftnot resultieren. Sie und andere Krankheiten müssen ausgeschlossen werden.
COPD oder Asthma? Wichtige Abgrenzung
Asthma und COPD sind die zwei häufigsten chronischen Atemwegserkrankungen. Beide werden durch eine Entzündung in den Atemwegen ausgelöst und unterhalten. Wichtig zu wissen aber ist, dass es sich um zwei unterschiedliche Formen von Entzündung handelt.
Die wichtigste Krankheit, die ausgeschlossen werden muss, ist somit das Asthma. Der wichtigste Grund dafür ist, dass wir beim Asthma die ablaufende Entzündung gut behandeln können, bei der COPD dagegen „noch“ (?) nicht.
Die zwei Krankheitsbilder im Gegensatz, für den Laien formuliert:
- ASTHMA: Beim Asthma führt die spezielle Entzündung zu einer Überempfindlichkeit der Atemwege. Der Kontakt mit einem Auslöser, d.h. das Inhalieren eines dieser Auslöser löst sofort eine Verkrampfung der Muskulatur aus, die die Bronchien umgibt und führt zu einer plötzlichen Verengung. Im Gegensatz zur Überzeugung der meisten Menschen muss das nicht unbedingt zu Luftnot führen. Die allermeisten Betroffenen verspüren einen quälenden trockenen Hustenreiz, eventuell auch ein Engegefühl in der Brust, vielleicht sogar Luftnot. Wiederholt auftretender Hustenreiz sollte immer auch an Asthma denken lassen. Etwa 40% der Menschen, die immer wieder husten müssen, leiden unter einem Asthma. Zusätzlich, aber eher selten kommt noch etwas vermehrte Schleimbildung hinzu. Dieser ist zäh wie Weingummi und kann als Resultat einer allergischen Reaktion auch gelblich verfärbt sein, was leicht mit einer bakteriellen Bronchitis verwechselt werden kann. Auslöser für Asthma können u.a. Pollen von Bäumen und Gräsern, Hausstaubmilben, genauer deren pulverisierter Kot, Infektionen, unspezifische Gerüche, Infekte und auch sportliche Betätigung sein. Typisch für ein Asthma ist der Wechsel zwischen „normal“ weiten und plötzlich verengten Atemwegen. Es wechseln Phasen mit völligem Wohlbefinden mit plötzlichen Beschwerden.
- COPD: Im Gegensatz dazu beginnen sich die Atemwege bei der COPD mit Beginn der Krankheit langsam, aber stetig weiter zu verengen und lassen sich nur wenig erweitern. Bei der COPD tritt die Luftnot deswegen nicht in Ruhe, z.B. im Sitzen auf. Der Patient verspürt erst Luftnot, wenn er sich anstrengt und dann je nach Intensität der Verengung früher oder später an seine Belastungsgrenze kommt.
Zusammengefasst und verständlich formuliert, bekommt der Asthmatiker seine Beschwerden plötzlich und jederzeit im Sitzen ohne Anstrengung, auch nachts, während der COPD-Patient nachts gut schlafen kann und seine Beschwerden erst entwickelt, wenn er sich anstrengt.
Asthma und COPD? ACO = Asthma-COPD-Overlap
Selbstverständlich kann ein Asthmatiker auch als zweite Krankheit eine COPD entwickeln, wenn er den entsprechenden Noxen ausgesetzt ist. Warum sollte ein Asthmatiker, der raucht, nicht auch noch zusätzlich eine COPD entwickeln können?
Der Betroffene leidet dann unter zwei Krankheiten mit verschiedenen Auslösern und Entzündungen, die sich unabhängig voneinander entwickelt haben und auch unterschiedlich behandelt werden.
Ist eine Behandlung nötig und ratsam? Die Beantwortung dieser Frage erfolgt in meinem nächsten Beitrag: COPD III.
Quellen:
– Foto: Koldunov / istock.com


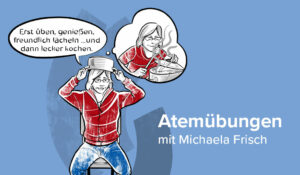





Sehr geehrter Herr Hausen,
ich danke Ihnen herzlich für Ihren Bericht und erzähle gerne einmal, was ich mit meinem Lungenfacharzt und einem zweiten erlebt habe. Sie werden vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Ich sollte zum CT statt MRT, weil, so der O-Ton der Lungenfachärztin, ein CT strahlungsärmer als ein MRT sei!
Als ich dem widersprochen habe, ihr die Argumente ausgingen, stellte sie die Totschlagfrage: „Sagen Sie mal, wer hat Medizin studiert, Sie oder ich?“
Ja, nicht zu glauben.
Da sie mir die Röntgenaufnahme nicht erklären und nicht zeigen wollte, weil „ja noch andere Patienten im Wartezimmer sitzen“ und sie sich weigerte, meine Fragen zu beantworten, mich nicht zu Wort kommen ließ und nur noch rumschrie, bin ich aufgestanden und wortlos gegangen, nachdem sie mich wieder gefragt hat „Sagen Sie, haben Sie Medizin studiert oder ich?“
Bei einem anderen Lungenfacharzt, um mir eine Zweitmeinung einzuholen, lief es folgendermaßen: er sagte, er könne zu der Röntgenaufnahme nichts sagen, ich müsse zum Radiologen, er könne mir keine Zweitmeinung geben. Ich hab ihn dreimal gefragt, ob das sein Ernst sei, auf seiner Webseite stehe schließlich groß und fett ‚auch für eine Zweitmeinung sind wir da’ und als ich anrief wegen eines Termins, hab ich explizit gesagt, dass ich eine Zweitmeinung einholen möchte und nun wolle er mir weissmachen, dass er als Lungenfacharzt mit, ich weiß nicht, 30-, 40-jähriger Erfahrung, ein Röntgenbild nicht lesen kann??!
Nicht zu fassen.
Mit den Worten „und sowas nennt sich Arzt“ habe ich auch diese Praxis verlassen. Einfach unglaublich, was sich Ärzte erlauben!
Lange Rede, kurzer Sinn, wenn Sie mir einen Fachmann (muss nicht studiert haben 😆) nennen können, in und um Düsseldorf, der COPD mit alternativen Mitteln zu behandeln weiß, so wie ich es größtenteils tue, würde ich mir Kontaktdaten freuen und sage herzlichen Dank!
Dolores Mihalko
Sehr geehrte Frau Gronemeyer,
Ich habe lange nachdenken müssen, ob und wie ich Ihnen helfen könnte. Leider fehlen mir als Arzt zu viele Informationen, um überhaupt einen wirksamen Rat geben zu können und nicht noch mehr für Verwirrung zu sorgen.
Meinen Patienten habe ich immer gesagt, dass sie zum Experten ihrer Krankheit werden müssen, um zusammen mit dem Arzt den bestmöglichen Weg zu wenig bis keinen Beschwerden zu finden. Dazu gehört auch, dass der Arzt nach Abschluss der Diagnostik Informationen zur gefundenen Erkrankung und Informationen zur Therapie vermittelt. So werden Sie das auch im Herbst 2026 in meinem Ratgeber nachlesen können.
Sie leiden unter dem Husten. Nebenbei bemerkt, ist Husten eines der quälendsten Symptome, die wir kennen. Und manchmal ist eine Linderung auch schlecht oder nicht möglich. Geben Sie Ihrem Arzt die Möglichkeit, Ihnen das Problem zu erklären und Ihnen zu helfen. Will oder kann er das nicht zu Ihrer Zufriedenheit, bleibt Ihnen nur ein Wechsel. Letztendlich geht es um Sie und Ihr Wohl.
Viele Grüße
Th.Hausen
Liebe Ingrid Gronemeyer, kurz und bündig Arzt Wechsel. Viel Glück und allen gute Luft
Ich huste auch die ganze Nacht ich bekomme nichts dafür ich musste diese Tage predniolon nehmen sonst bekomme ichs ich bin auch was mit der lunge ich nehme nichts ein und bekomme auch nichts für meine bronchen